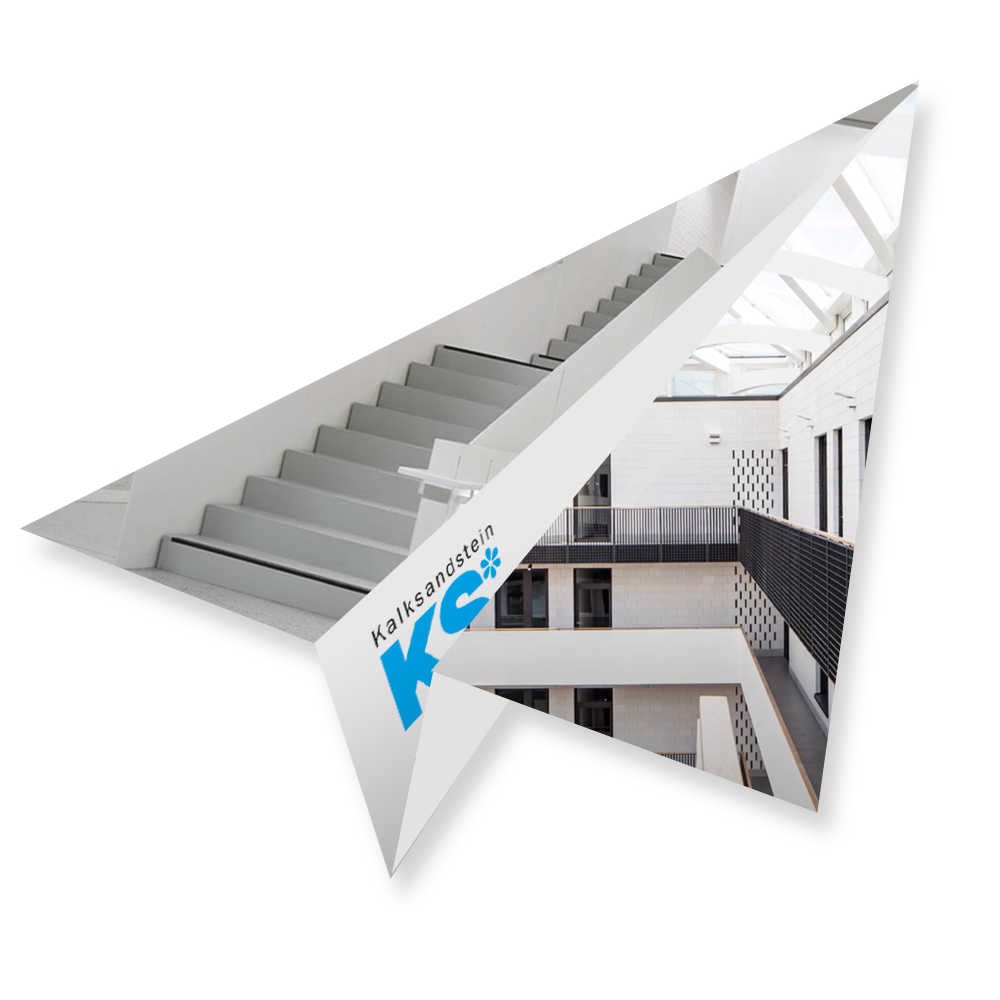Pro und Contra
Mit dem Konzept der 15-Minuten-Stadt wird aus Verkehrsraum Lebensraum. Parkplatzflächen können begrünt und zu Orten der Begegnung und Erholung werden. Sie würden sogar zur Abkühlung von Städten in Hitzeperioden beitragen. Autofahrer*innen dürften sich von dem Konzept autofreier Städte sowie eventueller Zufahrtskontrollen durchaus benachteiligt sehen. Die Städte und Gemeinden sind zudem gefordert, Lösungen zum Abstellen der verbliebenen Autos, wie zum Beispiel Quartiersgaragen, zu finden oder größere Park-and-Ride-Flächen außerhalb der autofreien Zonen einzurichten. Schon Pilotprojekte wie die Umwandlung der Berliner Friedrichstraße in eine „Flaniermeile“ legen – medial vielbeachtet – mögliche Konflikte offen: Während sich die einen über mehr öffentlichen Außenraum und die Fortbewegung zu Fuß oder per Rad freuen, klagen Ladenbesitzer*innen über Umsatzeinbrüche. Was würde das Konzept dann wohl für die klassischen Innenstädte bedeuten? Denkbar wäre, dass eine stärker eingeschränkte Erreichbarkeit mit dem Auto sich zum weiteren Sargnagel für die darbenden Einkaufsstraßen erweist. Andererseits sind sich viele Expert*innen längst einig, dass es neue Konzepte braucht, um ihre Zukunft zu sichern. Vielleicht wäre eine Umwandlung der einstigen Konsumtempel in Wohn- und Arbeitsraum da sogar eine Möglichkeit, wieder mehr Leben in die Fußgängerzonen zu bringen. Vielleicht führt die Entwicklung in den Stadtzentren auch wieder zu einer Reaktivierung und Stärkung vorhandener Stadtviertel-Strukturen, die per se schon kürzere Wege, weniger Verkehr und dadurch zum Teil auch mehr Lebensqualität bieten können. Es gibt also viele Einflüsse, die im System Stadt zusammenfließen und sich gegenseitig bedingen. Ob 15-Minuten-Stadt oder ein anderes Konzept. Wir brauchen ein Umdenken, um Städte durch eine Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und sozialer Gerechtigkeit zukunftsfähig weiterzuentwickeln.